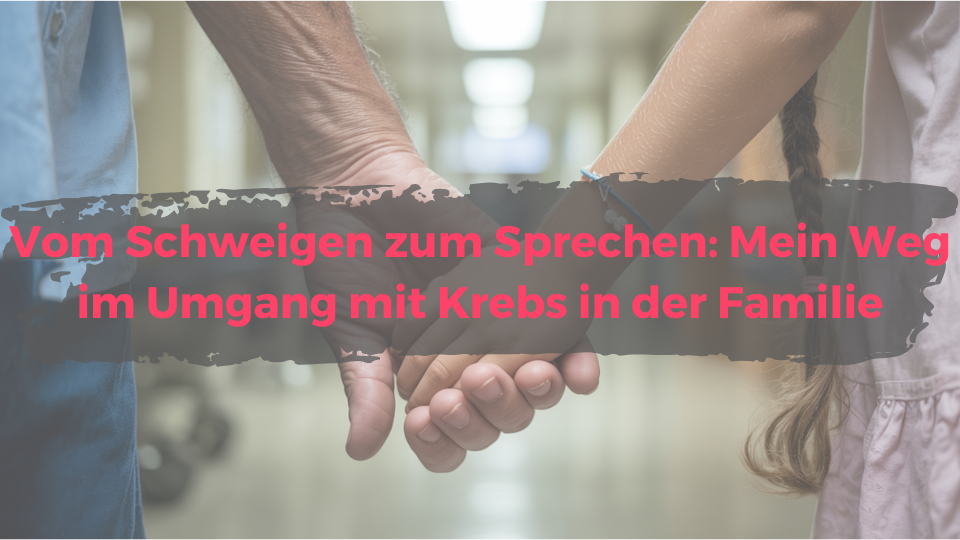Im letzten Jahr hat uns eine Krebsdiagnose in der Familie getroffen.
Das Telefonat kam unerwartet – und die Info hat mich eiskalt erwischt.
Die Nachricht über den Krebsfall in der Familie ließ mich sprachlos und wie eingefroren zurück.
Nicht nur, weil diese Krankheit in der Familie neu war – sondern weil sie alte Wunden aufgerissen hat.
Zum Glück hatte ich mich einige Monate zuvor intensiv mit dem Thema Krebs in der Familie beschäftigt.
Nicht freiwillig, sondern weil ich die Buchprojekte von Sandra Polli-Holstein begleitet habe.
Die Bücher rumgeKREBSt* und ausgeKREBSt* – zwei Titel, die auf den ersten Blick leicht daherkommen.
Doch in ihrem Innersten berühren sie genau das, worüber sonst kaum jemand spricht: Angst, Schmerz, Leben und Tod.
Und mir haben sie gezeigt, wie lange ich innerlich mit einer Krankheit in der Familie und mit dem unbearbeiteten Thema der Vergangenheit rumgekrebst hatte.
Die Arbeit mit diesen Texten war wie ein behutsames Aufräumen in meinem eigenen emotionalen Keller.
Ich hatte mich dem Thema schon gestellt, doch ausgekrebst war es noch nicht.
Mit einem Telefonat war es plötzlich wieder da, ganz persönlich, anders und intensiv.
Hinweis: Als Service für dich habe ich im Beitrag Produkte oder Dienstleistungen verlinkt. Affiliate-Links sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Ich erhalte bei deinem Einkauf eine Provision, ohne dass du mehr zahlst.
Zwischen Kontrolle und Kontrollverlust
Diesmal war ich nicht mehr das stille Kind, das im Schatten einer familiären Krebserkrankung nur zuschauen konnte.
Ich war erwachsen und habe eine wichtige Aufgabe übernommen.
Geduldig saß ich in Wartezimmern, füllte Unterlagen aus und begleitete mein Familienmitglied zu Arzt- und Krankenhaus-Terminen.
Ich führte Gespräche, half beim Finden von Entscheidungen.
Das gab mir Halt – weil ich das Gefühl hatte, etwas tun zu können.
Doch irgendwann kam der Moment, an dem ich zusehen musste, wie alte Muster bei der erkrankten Person wieder Einzug hielten.
So, als wäre der Krebs nichts weiter als ein Schnupfen gewesen.
Ein unangenehmer Zwischenfall – und nun bitte weitermachen wie vorher.
Als wäre der Schuss vor den Bug nicht klar und deutlich gewesen, dass es Zeit für eine Veränderung ist.
Ich spürte Wut, Traurigkeit, tiefe Verlustangst – wahrscheinlich typische Gefühle, wenn Krebs in der Familie das Leben auf den Kopf stellt.
Aber ich wusste auch: Diese Person trifft ihre eigenen Entscheidungen. Anders als ich sie treffen würde, wenn ich in der Situation wäre.
Ich habe mich seitdem bewusst emotional vom Thema distanziert.
Nicht, weil mir der Mensch egal ist – ganz im Gegenteil, sondern weil ich wollte, dass die gemeinsame Zeit, die uns bleibt, nicht vom Krebs dominiert wird – sondern von kleinen, kostbaren Momenten, die uns zeigen, dass das Leben trotzdem schön ist.
Damals, mit zehn, war das ganz anders.
Du willst mehr von mir lesen?
Dann checke jetzt in mein Mut-Mach-Manöver ein.
Als ich zehn war und keiner mit mir sprach
Irgendwas ist mit Oma.
Sie ist im Krankenhaus. Meine Tante zieht wieder bei meinen Großeltern ein.
Meine Cousinen kommen in die Kita um die Ecke. Es ist nicht für lange, sagen sie.
Dann kommt der Tag, an dem wir – meine Eltern, mein Bruder, meine Cousinen und ich – ins Krankenhaus fahren. Oma sieht anders aus.
Blass. Müde. Irgendwie ist sie viel dünner.
Sie sagt Sachen, die sie sonst nie sagt. Und sie weint.
Wir weinen.
Niemand sagt es, aber ich fühle es: Ich sehe sie zum allerletzten Mal.
Über Krankheiten wird bei uns nicht gesprochen.
Und morgen ist ein neuer Tag – so ist das bei Kindern.
Morgen ist alles wieder gut.
So ist es in meiner Welt.
Ein paar Wochen später komme ich fröhlich von der Schule nach Hause.
Meine Mutter weint. Meine Stimmung kippt in Unsicherheit.
„Ist doch kein Grund, zu weinen. Ist doch nicht so schlimm.“, bekomme ich meist zu hören, wenn ich weine.
Ich umarme sie, will sie trösten, alles wiedergutmachen – aber sie hört nicht auf.
Meine andere Oma ist auch da. Sie weint mit.
Ich fühle unendliche Traurigkeit und Schmerz, aber keiner redet mit mir.
Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Das fühlt sich nicht gut an.
„Oma ist gestorben“, sagt meine Mutti schließlich.
Dann weint sie weiter und ich weine mit.
Zur Beerdigung dürfen wir Kinder nicht mit.
Stattdessen sitzen mein Bruder, meine Cousinen und ich bei Opas Nachbarin am Tisch.
Es gibt Spaghetti mit Tomatensoße.
So schmeckt Ausgrenzung.
So riecht Verdrängung.
So fühlt es sich an, wenn man sich nicht verabschieden kann.
Wie mit Krebs in der Familie umgehen?
Diese Frage habe ich mir lange nicht gestellt.
Ich hatte die Krebskiste ordentlich verschlossen und tief in meinem mentalen Keller verstaut.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Dachte ich.
Das Thema „Krebs in der Familie“ war erfolgreich verdrängt.
Aber Gefühle lassen sich nicht einfach archivieren.
Sie bleiben da. Brodeln.
Bis sie nach oben kochen – damit sie endlich gefühlt und betrachtet werden.
Als meine Autorin mit ihren Buchprojekten kam, wurde mir bewusst, wie viel von meinem kindlichen Erleben noch in mir wirkte und was es bedeutet, wenn Erwachsene nicht mit Kindern sprechen – aus Schutz, aus Angst oder aus Überforderung.
Heute sage ich:
Eine Krebserkrankung in der Familie zu bewältigen heißt, Gefühle zuzulassen – nicht, Kontrolle behalten zu wollen.
Mit einer Krankheit in der Familie umzugehen – und mit Kindern darüber zu sprechen – heißt für mich:
Ehrlich zu sein, auch wenn es weh tut.
Verständnis zu zeigen – für andere und für sich selbst.
Fragen zuzulassen und gemeinsam Antworten zu finden.
Und vor allem: Gefühle nicht wegzuschieben, sondern sie da sein zu lassen.
Was ich daraus gelernt habe
Wenn ich heute zurückschaue, dann nicht mit Vorwürfen.
Meine Eltern wollten mich schützen, mir Leid ersparen und ich verstehe das.
Aber ich weiß auch: Das Schweigen hat mich mehr verletzt als die Wahrheit es je gekonnt hätte.
Ich glaube, sie wollten in dieser Situation auch sich selbst schützen, denn noch mehr Emotionen hätten sie damals vermutlich nicht ausgehalten.
Vielleicht war da auch die Angst, keine Antworten auf meine Fragen zu haben.
Fragen von Kindern können genau das bewirken.
Sie konfrontieren.
Sie bringen ins Denken und ins Fühlen – immer wieder.
Mit dem, worüber man eigentlich nicht nachdenken und was man nicht fühlen will.
Ich bin heute dankbar, dass ich durch Buchtherapie gelernt habe, wie man eine Krankheit in der Familie aufarbeitet – auch emotional.
Denn nach Loreleys Diagnose konnte ich vieles anders machen.
In diesem Blogartikel erfährst du mehr über meine Buchtherapie zu Loreley.
Unsere Kinder wussten immer, warum ich traurig war, weil wir ehrlich über die Krankheit in der Familie gesprochen haben.
Wir haben mit ihnen gesprochen – offen, kindgerecht, ehrlich.
Nicht jedes Detail, aber das, was sie wissen mussten und verstehen konnten.
Und sie hatten und haben immer die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen.
Und was macht das mit den Kindern?
Was es mit Kindern macht, wenn niemand mit ihnen spricht und wie du Themen, wie eine Krankheit in der Familie kindgerecht, ehrlich und verständlich besprichst, erfährst du in diesem Blogartikel.
Impulse von mir. Fü(h)r dich.
Gedanken, Fragen und Perspektiven für Führungskräfte.
Du wirst Teil meiner Community. Abmeldung jederzeit mit einem Klick möglich.